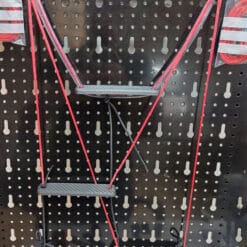Nachweis der „ausreichenden fliegerischen Übung“ – was ab 2026 auf DHV-Piloten zukommt
Der DHV hat seine Ausbildungs- und Prüfungsordnungen überarbeitet. Hintergrund ist eine Aufforderung des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA), den „Nachweis der ausreichenden fliegerischen Übung“ nach § 45 Abs. 4 LuftPersV künftig konkret und messbar zu regeln. Auslöser waren zwei tödliche Hängegleiter-Unfälle im Zusammenhang mit UL-Schlepp-Einweisungen, woraufhin die bisherige sehr weiche Formulierung („solange dem DHV nichts bekannt ist…“) von der Aufsichtsbehörde als unzulässig eingestuft wurde.
Ab 1. Januar 2026 gelten daher neue Mindestanforderungen – sowohl für Gleitschirm- als auch für Hängegleiterpiloten.
Was ändert sich für Gleitschirmpiloten?
Für Inhaber des beschränkten und unbeschränkten Luftfahrerscheins für Gleitsegelführer definiert der DHV künftig klare Mindeststandards:
Innerhalb der letzten 24 Monate muss wahlweise
entweder eine bestimmte Anzahl von Flügen mit einem Gleitschirm in einer der in der Lizenz eingetragenen Startarten nachgewiesen werden (aktuell sind es 10 Flüge),
oder das fliegerische Können wird von einem Fluglehrer, Fluglehrer-Anwärter oder Prüfer bestätigt.
Nach Ablauf dieser 24 Monate reicht das Flugbuch allein nicht mehr: Dann kann die „ausreichende Übung“ nur noch durch eine Bestätigung des Könnens durch Fluglehrer/Prüfer belegt werden.
Für Passagierberechtigungen kommen zusätzliche Punkte dazu:
Innerhalb von 36 Monaten ist ein Überprüfungsflug mit Passagier vor einem Fluglehrer oder Prüfer erforderlich.
Wird dieser nicht rechtzeitig durchgeführt, ruht die Passagierberechtigung, bis Nachschulung und Überprüfungsflug nachgeholt sind.
Unverändert bleibt die bekannte 90-Tage-Regel: Wer Passagiere mitnehmen will, muss in den letzten 90 Tagen mindestens drei Starts und Landungen mit Gleitschirm geflogen haben (§ 45a LuftPersV).
Was gilt für Hängegleiterpiloten?
Für Hängegleiterführer gelten vergleichbare Regeln, ergänzt um spezielle Anforderungen für den UL-Schlepp:
Innerhalb von 24 Monaten sind Flüge in den eingetragenen Startarten (Hang, Winde, UL-Schlepp) nachzuweisen oder das Können wird durch Fluglehrer/Prüfer bestätigt.
Für die Startart UL-Schlepp müssen mindestens fünf dieser Flüge als UL-Schleppstarts erfolgt sein; fehlt dieser Nachweis, ist eine Nachschulung in einer berechtigten Flugschule fällig.
Auch hier gibt es für Passagierberechtigungen den 36-Monats-Überprüfungsflug und die 90-Tage-Regel für Starts/Landungen mit Hängegleiter.
Dokumentationspflicht: Flugbuch bleibt Pflicht – analog oder digital
Neu ist nicht das Flugbuch an sich, sondern die Klarheit, mit der es nun eingefordert wird. Der DHV verlangt eine schriftliche oder digitale Dokumentation der relevanten Flüge. Auf Verlangen von DHV oder Luftaufsicht muss der Lizenzinhaber die Nachweise vorlegen können.
Gefordert werden unter anderem Angaben zu:
Name des Piloten
Datum
Fluggerät (Muster)
Startart
Flugdauer
Start- und Landeplatz
Ob diese Daten im klassischen Papier-Flugbuch stehen, in einer Excel-Liste, einem Online-Flugbuch oder in einem Export aus einem elektronischen System (z. B. Tracklog) – dazu äußert sich der DHV bislang nicht im Detail, sondern spricht allgemein von „schriftlich oder digital“.
Wie wird das in der Praxis kontrolliert?
Und hier beginnt die spannende – und ein wenig kritische – Seite der neuen Regelung.
Keine aktive Meldung: Die Dokumentation muss nicht an den DHV oder eine Behörde geschickt werden, sie wird nur „auf Verlangen“ vorgelegt.
- Kontrollsituation unklar: In der Praxis bedeutet das vermutlich: Kontrolle bei Auffälligkeiten, nach einem Unfall, im Rahmen der Luftaufsicht oder bei Nachfragen im Zusammenhang mit einer Ausbildung/Weiterbildung.
Bis tatsächlich etwas passiert – ein Vorfall, ein Unfall oder ein behördlicher Schwerpunkt – wird dieses Thema viele Piloten vermutlich eher theoretisch begleiten. So wie bei anderen Regelungen auch: solang nichts schiefgeht, interessiert die Dokumentation kaum jemanden, sobald etwas passiert, wird sie auf einmal sehr wichtig.
Was gilt als „digitale Dokumentation“?
Hier bleibt der DHV relativ offen – und das ist Fluch und Segen zugleich.
Realistisch ist zu erwarten, dass in der Praxis Online-Flugbücher wie etwa XContest, DHV-XC oder das Burnair Flugbuch als ausreichender Nachweis akzeptiert werden, sofern die Daten klar einem Piloten zugeordnet sind und die Mindestangaben (Datum, Gerät, Startart, etc.) nachvollziehbar sind.
Nicht eindeutig ist bisher:
Reicht ein reiner Tracklog im Instrument (z. B. Vario/GPS) als „Dokumentation“, oder braucht es einen Export in eine lesbare Form (PDF, CSV, Online-Profil)?
Genügt ein Screenshot aus einer App, oder müssen Flüge „offiziell“ in einem Online-System geloggt sein?
Solange es dazu keine klaren Beispiele oder FAQ-Antworten gibt, bleibt für Piloten und Schulen eine gewisse Rechtsunsicherheit.
Zusatzgeschäft für Flugschulen?
Ein Punkt liegt relativ klar auf der Hand:
Immer dann, wenn der 24-Monats-Zeitraum überschritten ist oder Piloten sich unsicher fühlen, wird der Weg zwangsweise über Flugschulen, Fluglehrer oder Prüfer führen.
Bestätigung des fliegerischen Könnens
Nachschulung in einer Flugschule
Überprüfungsflüge mit/ohne Passagier
All das sind Leistungen, die bezahlt werden müssen. Aus Sicht der Sicherheit lässt sich das gut begründen: wer lange nicht geflogen ist, profitiert objektiv von betreutem Wiedereinstieg. Gleichzeitig ist es aber auch ein zusätzlicher Umsatzstrom für Schulen, der in dieser Form direkt aus einer regulatorischen Verschärfung entsteht.
Ob dieser Effekt maßvoll bleibt oder ob sich daraus eine neue „Check-Industrie“ entwickelt, wird man erst in ein paar Jahren sehen.
Und was macht der Aeroclub?
Spannend ist die Frage, ob andere Verbände – etwa der Österreichische Aeroclub – ähnlich klare Nachweisregeln einführen werden oder ob man dort bei weicheren Formulierungen bleibt.
Momentan ist völlig offen, ob der Aeroclub denselben Weg gehen wird, ob es abgestimmte Lösungen im deutschsprachigen Raum geben soll oder ob sich nationale Sonderwege etablieren. Für Piloten mit mehreren Lizenzen (z. B. DHV und ÖAeC) wäre ein einheitlicher Rahmen sicher wünschenswert – garantiert ist das allerdings nicht.
Fazit: Sinnvolle Idee, aber viele offene Fragen
Die Grundidee hinter dem „Nachweis der ausreichenden fliegerischen Übung“ ist nachvollziehbar: Wer ein Luftfahrzeug führt – zumal mit Passagier –, sollte nicht nur „irgendwann mal“ eine Lizenz gemacht haben, sondern sein Können regelmäßig auffrischen.
Trotzdem bleiben einige Punkte offen:
Wie genau wird in der Praxis kontrolliert?
Welche digitalen Nachweise werden akzeptiert (XContest, Burnair Flugbuch, andere Systeme, Instrument-Tracks)?
Wo endet sinnvolle Sicherheit, wo beginnt reine Bürokratie oder Pflichtprogramm für zusätzliche Schulungsumsätze?
Bis die ersten konkreten Fälle aufschlagen – bei Kontrollen, Unfällen oder Streitfällen mit Versicherungen – wird das Thema für viele wohl eher im Hintergrund laufen. Doch eines ist sicher: Wer sein Flugbuch (analog oder digital) sauber führt und seine Flüge dokumentiert, ist auf der sicheren Seite – und muss im Zweifel nicht erst unter Zeitdruck alte Tracklogs zusammensuchen.
Accessoires